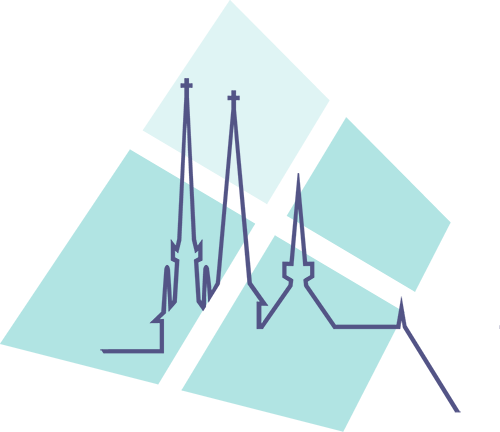Mor Polycarpus: „Die orthodoxe Kirche hat eine poetische Herangehensweise an die Glaubenswahrheiten.“
Interview mit dem Metropoliten der Syrisch-Orthodoxen Kirche in den Niederlanden.
Während eines Arbeitstreffens mit der Luxemburger Schule für Religion und Gesellschaft (LSRS) im Jean XXIII-Zentrum hatte ich das Glück, Mor ([1]) Polycarpus Augin Aydin zu treffen. Mor Polycarpus ist Metropolit und Patriarchalvikar der Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche in den Niederlanden. Am Tag zuvor hatte er auf Einladung von Professorin Annemarie C. Mayer, die auch außerordentliche Professorin an der LSRS ist, im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1700. Jahrestag des Konzils von Nicäa einen Vortrag in Trier gehalten. Prof. Jean Ehret, Direktor der LSRS, der ebenfalls in Trier anwesend war, lud Mor Polycarpus ein, die LSRS zu besuchen. Der Metropolit war so freundlich, mir ein spontanes Interview zu gewähren.
Eure Eminenz, gestern haben Sie einen Vortrag über das Konzil von Nicäa gehalten. Welche Bedeutung hat der 1700. Jahrestag dieses Konzils für die Christen?
Mor Polycarpus. Das Konzil von Nicäa, das 325 von Kaiser Konstantin einberufen wurde, war ein entscheidender Moment in der Geschichte der Kirche. Es befasste sich mit kritischen theologischen und kirchlichen Fragen und legte den Grundstein für eine einheitliche christliche Identität. Vor allem wurde das erste ökumenische Glaubensbekenntnis verabschiedet, das die Göttlichkeit Christi bekräftigte und ein gemeinsames Glaubensbekenntnis festlegte, das die christliche Lehre für die kommenden Jahrhunderte prägen sollte. Im Laufe der Zeit wurde dieses Glaubensbekenntnis in das liturgische Leben der Kirche integriert. In der syrisch-orthodoxen Tradition beispielsweise rezitieren wir das Glaubensbekenntnis am Ende jedes Gebets im Stundengebet sowie während der Göttlichen Liturgie, sodass es zu einem lebendigen Lobgesang unseres Glaubens an den dreieinigen Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist – wird.
Ein weiteres bleibendes Vermächtnis des Konzils von Nicäa war die Entscheidung, ein einheitliches Datum für die Feier des Osterfestes festzulegen. Dies war für die Bewahrung der Einheit der Kirche von entscheidender Bedeutung, da es sicherstellte, dass Christen auf der ganzen Welt das zentrale Geheimnis ihres Glaubens – die Auferstehung Christi – am selben Tag feiern.
Dieser 1700. Jahrestag lädt uns nicht nur dazu ein, tiefer über den theologischen Inhalt des Glaubensbekenntnisses nachzudenken, sondern auch unser Engagement für die sichtbare Einheit zu erneuern.
Kann dieses Jubiläum eine Gelegenheit für die verschiedenen christlichen Kirchen sein, einander näher zu kommen?
Es ist eine Zeit, gemeinsam voranzuschreiten. Am 20. Mai 2025 begannen die Feierlichkeiten zum 1700-jährigen Jubiläum. Vertreter der protestantischen, griechisch-orthodoxen und orientalisch-orthodoxen sowie der katholischen Kirche trafen sich in Nicäa. Papst Franziskus hatte geplant, nach Nicäa zu reisen, um die Bedingungen zu erörtern, unter denen wir ein gemeinsames Datum für Ostern festlegen könnten. Es heißt, dass Leo XIV. möglicherweise im November dorthin reisen wird.
In diesem Jahr haben wir Ostern am selben Tag gefeiert. Der Unterschied im Datum zwischen den katholischen und protestantischen Feierlichkeiten einerseits und den orthodoxen Feierlichkeiten andererseits ist nur eine Frage des Kalenders und keine theologische Frage. Einen Weg zur Einheit zu finden, wäre eine schöne Möglichkeit, die Konzilsväter von Nicäa zu ehren. In praktischer Hinsicht hatte der julianische Kalender gewisse Einschränkungen, aber auch der gregorianische Kalender ist nicht ganz genau. Es steht fest, dass Ostern auf einen Sonntag fallen muss, aber wie Papst Franziskus sagte, feiern wir keinen Kalender, wir feiern die Auferstehung!
Welchen Vorteil sehen Sie in einem gemeinsamen Termin für Ostern?
Sowohl aus theologischer als auch aus pastoraler Sicht wäre ein gemeinsamer Termin für Ostern ein sichtbarer Ausdruck der Einheit der Christen und würde das Zeugnis der Kirche in der Welt stärken. Ich werde oft gefragt, ob wir wirklich an denselben Christus glauben wie andere Christen – nämlich Katholiken und Protestanten –, da wir nicht einmal das Fest der Auferstehung am selben Tag feiern. Ein gemeinsames Datum würde dazu beitragen, solche Verwirrung auszuräumen und unseren gemeinsamen Glauben an den auferstandenen Herrn zu bekräftigen.
Es wäre auch von großem Nutzen für Familien in interkonfessionellen Ehen – ob katholisch-orthodox oder protestantisch-orthodox –, die sich danach sehnen, das zentrale Geheimnis ihres Glaubens gemeinsam zu feiern. Auf praktischer Ebene würde ein einheitliches Osterdatum die Urlaubsplanung für Schulen, Arbeitsplätze und Familien vereinfachen und die Koordination von kirchlichen Veranstaltungen und öffentlichen Glaubensbekundungen erleichtern.
Was sind die größten Herausforderungen für die syrisch-orthodoxe Kirche in den Niederlanden?
Eines unserer dringenden Anliegen ist die Integration syrisch-orthodoxer Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. Viele kommen traumatisiert an, weil sie Familienangehörige verloren haben. Ihre Kinder wachsen in einer Kultur und einem Klima auf, die sich stark von ihrer eigenen unterscheiden, und sind mit großer Unsicherheit konfrontiert. Einige geraten in die Kriminalität, und wir beobachten eine Zunahme von Familienzerbrüchen und Scheidungen.
Wir arbeiten hart daran, diesen Familien zu helfen, wieder ein Gefühl der Stabilität zu gewinnen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden und einen Sinn und Zweck zu finden. Die größte Herausforderung ist die Identität – viele haben die schmerzhafte Erkenntnis gewonnen, dass sie in absehbarer Zeit nicht in ihre Heimatländer Syrien, Irak oder Libanon zurückkehren können und nun einen Weg finden müssen, sich in ihrer neuen Umgebung ein neues Leben aufzubauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln.
Was den Glauben betrifft, sagen viele Katholiken, dass sie nicht mehr an das Dogma der Realpräsenz Christi in der Eucharistie glauben. Sind Sie in der syrisch-orthodoxen Kirche mit ähnlichen Phänomenen konfrontiert?
Die Frage des Dogmas hängt letztlich davon ab, wie es vermittelt wird. Einige Dogmen haben klare historische Grundlagen und sind für die Gläubigen leichter zugänglich. Andere sind abstrakter und erfordern einen anderen Ansatz, um vollständig verstanden zu werden. Sollten wir sie mit wissenschaftlichen, rationalen Begriffen erklären – oder durch die Brille des Glaubens und der spirituellen Einsicht? In der syrisch-orthodoxen Kirche greifen wir oft auf poetische und symbolische Sprache zurück, um die tieferen Wahrheiten des Glaubens zu vermitteln.
Nehmen wir zum Beispiel die Taufe. In unserer Tradition wird das Taufbecken mit dem Schoß einer spirituellen Mutter verglichen, aus dem Söhne und Töchter neu geboren werden. Durch die Taufe werden sie mit dem Gewand der Herrlichkeit bekleidet, das Adam und Eva im Paradies verloren haben. Wenn die Neugetauften aus dem Wasser der Wiedergeburt auftauchen, werden sie sofort zum heiligen Altar gebracht, um die Eucharistie zu empfangen. In diesem Moment verkündet der Priester: „Die Frucht, die Adam im Paradies nicht kosten durfte, wird dir heute freudig in den Mund gelegt.“
Diese symbolische und bildreiche Sprache hilft den Gläubigen, theologische Realitäten nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen zu begreifen, sodass sie das Geheimnis auf eine zutiefst persönliche und spirituelle Weise verinnerlichen können.
Besonders schätze ich das Werk der amerikanischen Schriftstellerin Kathleen Norris. Sie verbrachte einige Zeit in der Abtei Saint John's in Minnesota und hielt ihre Erfahrungen in dem Buch „The Cloister Walk“ fest. In „Amazing Grace: A Vocabulary of Faith“ reflektiert sie anhand persönlicher Geschichten über den Wortschatz des Glaubens und macht komplexe Konzepte zugänglich. Wie sie sagt – und ich stimme ihr zu –, muss man nicht warten, bis man vollständig bereit ist, um mit dem Beten zu beginnen, sondern muss manche Wahrheiten erst glauben, bevor man sie vollständig verstehen kann.
[1] „Mor” ist ein syrischer Ehrentitel, der „Mein Herr” bedeutet. Er wird traditionell als respektvolle Anrede für Bischöfe, Heilige und andere hochrangige Geistliche in der syrisch-orthodoxen Kirche und anderen syrisch-christlichen Traditionen verwendet. Der Titel hat seinen Ursprung in der aramäischen Sprache Jesu und der frühen Kirche und drückt sowohl spirituelle Autorität als auch liebevolle Ehrfurcht aus.
Warum feiern nicht alle christlichen Kirchen Ostern am selben Tag?
Für alle Christen ist Ostern, die Auferstehung, der Höhepunkt des liturgischen Jahres. Das Konzil von Nicäa im Jahr 325 legte das Datum des Festes auf den ersten Sonntag nach dem Vollmond nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche fest. Zu dieser Zeit war der julianische Kalender der Standard. Dieser von Julius Cäsar geschaffene Kalender verlängerte das Jahr jedoch um elf Minuten. Im Jahr 1582 strich Papst Gregor XIII. zehn Tage und reformierte den Kalender. Die westlichen Kirchen übernahmen den Gregorianischen Kalender, die orthodoxe Kirche behielt jedoch den Julianischen Kalender bei. Alle christlichen Kirchen berechnen Ostern nach der Regel des Konzils von Nicäa, wenden diese jedoch auf zwei verschiedene Kalender an, was zu Unterschieden führen kann.
Anmerkung: Das Interview wurde auf Englisch geführt, den Originaltext finden Sie hier.
Obrigado por ler este artigo. Se quiser manter-se informado sobre as notícias da Igreja Católica no Luxemburgo, subscreva o Cathol-News, enviado todas as quintas-feiras, clicando aqui.
Cabeçalho
-
Mor Polycarpus: „Die orthodoxe Kirche hat eine poetische Herangehensweise an die Glaubenswahrheiten.“
Interview mit dem Metropoliten der Syrisch-Orthodoxen Kirche in den Niederlanden.
-
Für die Bildung in Unterscheidung
Beten wir, dass wir lernen immer mehr zu unterscheiden, die Lebenswege zu wählen wissen und all das abzulehnen, was uns von Christus.
-
Eng lescht diözeesan Roumrees vum 31. August - 6. September 2025
Als Pilger vun der Hoffnung wëlle mir äis am Jubiläumsjoer mam Bus eng leschte Kéier an d’Helleg Stad op de Wee maachen, fir e Stéck Weltkierch ze…
-
Mgr. Coppola: „Der Heilige Vater braucht unsere Gebete“
Der Nuntius feierte das Pontifikalamt anlässlich des Amtsantritts von Papst Leo XIV.